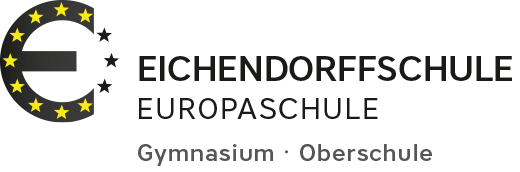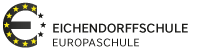Dieser Herausforderung stellen sich Schüler und Lehrer der Eichendorffschule, indem in den letzten vier Jahren Projekte entstanden, die die Beteiligten über den Tellerrand hinausschauen lassen:

Glencree, Irland
Seit unserem ersten Besuch im Jahr 2022 haben unsere Schüler neun QR-Codes mit Biographien und allgemeinen Informationen zu der deutschen Kriegsgräberstätte Glencree aufgestellt. Durch diese QR-Codes werden immer wieder deutsche und irische Besucher des Friedhofes auf unser Projekt und somit auch auf die Eichendorffschule aufmerksam und lassen uns sehr positive Rückmeldungen zukommen. Darüber hinaus versorgen uns manche Besucher mit weiteren Hinweisen zu den dort Ruhenden bzw. zu den Ereignissen, die zu ihrem Tode führten. So sind schon vielfältige Kontakte sowohl in Irland als auch in Deutschland entstanden. Jährlich beschäftigen sich Schüler des 9. Jahrgangs der Oberschule und des 10. Jahrgangs des Gymnasiums damit, neue Biographien zu erstellen und neue Ideen der Präsentation zu entwickeln.
Besonders gefreut hat uns, dass das ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) Gloucester, UK an uns mit der Bitte herangetreten war, beteiligte Schüler vor Ort zu treffen. Vier Schüler des 10. Und 11. Jahrgangs und zwei Lehrkräfte machten sich im Mai auf den Weg und bereiteten dafür eine PowerPoint zu unserem Projekt und den geschichtlichen Hintergründen vor. Die Bewertung der Schülerleistung durch den leitenden Soldaten lautete dazu:
Im Rahmen einer Projektarbeit der Eichendorffschule haben Sie (die Schüler) die geschichtlichen Hintergründe derer, die in Glencree, Irland auf dem dortigen deutschen Soldatenfriedhof ihre letzte Ruhe gefunden haben, recherchiert und durch an den Gräbern angebrachte QR-Codes für interessierte Besucher des Friedhofes abruf- und erlebbar gemacht. Allein hierfür gebührt Ihnen der Respekt und die Anerkennung eines jeden Soldaten, gleich welcher Nation. Bei einem Kriegsgräberfürsorgeeinsatz der Soldaten des Deutschen Anteils des Allied Rapid Reaction Corps aus Gloucester, UK haben Sie (die Schüler) sich darüber hinaus völlig uneigennützig dazu bereit erklärt, meinem Team von Soldaten einen Vortrag zu Ihrer Projektarbeit selbst sowie zu den durch Sie erarbeiteten Historien zu halten. Die Hintergründe und Einsichten, die Sie (die Schüler) dabei vermittelten, trugen im erheblichen Maße zu der durch Soldaten der Bundeswehr jährlich durchzuführenden Persönlichkeitsbildung -welche sowohl historische wie auch politische Weiterbildung inkludiert - bei. Besonders beeindruckend war dabei die durch Sie an den Tag gelegte Souveränität, mit der Sie vor Ihnen unbekannten Soldaten, im Schwerpunkt Offizieren, ein hochkomplexes und sensibles Thema vortrugen. Auch Rückfragen meiner Soldaten beantworteten Sie ohne Berührungsängste und machten Ihre Vertrautheit mit Ihrem Projekt, und die Leidenschaft, welche Sie in dieses investiert haben, überdeutlich.
Zudem fand ein sehr anregender Austausch mit den Soldaten, dem stellvertretenden Botschafter und dem evangelischen Pastor statt, die die Zeremonie der Kranzniederlegung begleiteten. Auch hierbei leisteten die Schüler einen Beitrag mit Fürbitten und kurzen Texten.
Anne-Frank-Tag 12. Juni
Seit 2024 finden Projekte für die Jahrgänge 5, 7 und 9 statt:
Die Schüler der 5. Klasse setzen sich mit dem Buch „Hanas Koffer“ von Karen Levine auseinander. Ähnlich wie Hana 1942 packen die Schüler einen kleinen Koffer mit verschiedenen Gegenständen, die beim Aufbruch in eine ungewisse und unsichere Zukunft hilfreich sein könnten. Dabei müssen sie bedenken, was zum Leben wirklich notwendig ist und als Klasse eine Lösung aushandeln. Anschließend wird der Koffer über eine gewisse Distanz getragen, um zu verdeutlichen, wie schwer er ist.
Der Jahrgang 7 wird über den Kurzfilm „Sandrine“ aus der Reihe „Der Krieg und
ich“ für die Situation von Kindern sensibilisiert, deren Eltern als Unterstützer verfolgter
Menschen aktiv waren. Die Schüler können nachvollziehen, wie die 13-jährige Sandrine nach
anfänglicher Skepsis die Beweggründe ihrer Eltern zu verstehen lernte, auch wenn sie selbst
persönliche Einschränkungen hinzunehmen hatte. Sandrines Leid und ihr sich wandelnder
Blick auf die Situation der untergetauchten Juden halten die Schüler in Briefen fest, die sich
auf unterschiedliche Weise mit den Ereignissen des Films auseinandersetzen.
Die wohl ergreifendste Aktion im Rahmen dieses Projekts erfahren die 9. Klassen. Für
sie geht es in das Hinterhaus, in dem Anne Frank und ihre Familie sich zwischen 1942 und
1944 versteckt hielten. Dieses Versteck wird in einem engen und abgedunkelten Raum der
Schule mithilfe verschiedener Möbel und Requisiten nachgebildet. Nach einer kurzen
Einführung in Annes Geschichte durch Schüler des 12. Jahrgangs erhalten die Neunt- und
Zehntklässler Rollenkarten, die ihnen bestimmte Charaktere innerhalb der Familie Frank und
ihrer Mitbewohner zuweisen. Mit diesem Wissen werden sie durch einen abgedunkelten Gang
und der Aufforderung, dass sie sich ruhig und unauffällig zu verhalten haben, in den Raum
geleitet. Dort werden sie in Situationen verwickelt, die von ihnen im Sinne ihrer Rolle ruhig
und mit Bedacht gelöst werden müssen. So gibt es Streit zu schleichen, wenn Anne Herrn
Dussels Kekse gegessen hatte oder wenn Uneinigkeit darüber herrscht, wie Annes Geburtstag
gefeiert werden soll. Aber auch solch eine bedrohliche Situation wie ein Bombenangriff in der
Nachbarschaft, der durch Hintergrundgeräusche simuliert wird, haben die Teilnehmer der
Aktion zu bewältigen.
Im Nachgang des Erlebten werden die Reaktionen der Schüler eingefangen. Sie bezeichneten
die Erfahrung als „gruselig“, „beängstigend“, aber auch als „informativ“ und „realistisch“.
„Man fühlte sich absolut ungewollt,“ äußerte eine Schülerin des 9. Jahrgangs. Gleich mehrere
Schüler stellten sich die Frage, wann all dies endlich vorbei sei und erkannten somit die
Schwierigkeit, eine solche Situation zwei Jahre lang durchstehen zu müssen, die von
Dunkelheit, Isolation, Angst, Sorge, Einschränkungen, Ruhelosigkeit und dem Fehlen von
Privatsphäre geprägt war. Zutreffend resümierte ein Schüler das Erlebnis mit den Worten: „Ein
Schrecken, welchen ich nicht selbst erleben möchte.“
Rote Hand Aktion 12. Februar
Nach mehreren die gesamte Schulgemeinschaft betreffenden Aktionen in den Jahren zuvor fanden 2025 erstmalig Projekte für den 6., 8. und 10. Jahrgang statt.
Für die 6. Klassen ging es darum zu erfahren, was Kindersoldaten sind. Anhand eines Videos eines ehemaligen Kindersoldaten und dem Gedicht „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein“ von Rudolf Otto Wiemer setzen sie sich mit der Situation von Kindersoldaten auseinander.
Anschließend basteln und gestalten die Schüler gemeinsam einen Engel für die Klasse und einen ganz persönlichen Engel, den sie mit nach Hause nehmen.
Schüler des 8. Jahrgangs gestalten einen Gottesdienst, den sie mit dem gesamten Jahrgang durchführen. Dazu recherchieren sie Geschichten von Kindersoldaten, erarbeiten ein Rollenspiel, Fürbitten und Gebete. Beeindruckend ist die Stille und Aufmerksamkeit, die während des Gottesdienstes herrscht.
Der 10. Jahrgang gestaltet eine Ausstellung zum Thema „Kindersoldaten“, die sowohl die wirtschaftlichen als auch politischen Hintergründe beleuchtet. Anhand von Bildern, kurzen Texten und Geschichten soll die Schulgemeinschaft so auf das Schicksal der ca. 250.000 Kindersoldaten weltweit aufmerksam gemacht werden.